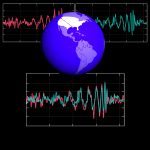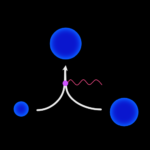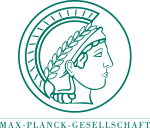Zehn Jahre Gravitationswellenastronomie
Am 14. September 2015 wurden sie erstmals beobachtet: Gravitationswellen, die beim Verschmelzen zweier Schwarzer Löcher entstehen und sich als Verzerrungen der Raumzeit durch das Universum ausbreiten. Da diese Verzerrungen sehr (sehr!) klein sind, war die Beobachtung eine Sensation, die schon kurz danach – im Jahr 2017 – mit dem Nobelpreis für Physik für führende Wissenschaftler der LIGO-Detektor-Kooperation ausgezeichnet wurde. Zehn Jahre später ist die Gravitationswellenastronomie weiter fortgeschritten: Im aktuellen vierten Beobachtungsdurchgang der nunmehr vier miteinander kooperierenden Detektoren werden pro Jahr etwa hundert Ereignisse gemeldet.
Ein Artikel von Jens Kube
Das erste „Wuiippp!“
Im September 2015 waren es die beiden LIGO-Detektoren in Hanford und in Livingston (beides USA), bei denen erstmal das charakteristische Signal der immer schneller und intensiveren Gravitationsverzerrung sichtbar (und hörbar) wurde. Ausführlich haben wir diese erste Beobachtung von GW150914 hier auf Einstein-Online dargestellt. Die technische Leistung dieser ersten Beobachtung bleibt auch zehn Jahre später beeindruckend: In den beiden L-förmigen Detektoren wurde die Längenveränderung der vier Kilometer langen L-Arme um weniger als ein Tausendstel Durchmesser eines Wasserstoffatomkerns vermessen. Dabei war das kosmische Ereignis, das diese Wellen erzeugte, extrem kräftig: Zwei Schwarze Löcher mit 29 und 36 Sonnenmassen verschmolzen miteinander und strahlten dabei den Energiegehalt von drei Sonnenmassen in Form von Gravitationswellen ab. In den letzten 0,2 Sekunden des Verschmelzungsprozesses setzte dieses Ereignis damit mehr als zehnmal so viel Energie frei wie alle Sterne des Universums zusammen!
Schwarze Löcher und Neutronensterne
Die Vorgängerobjekte solcher Gravitationswellenobjekte sind die Überreste massereicher Sterne. Für GW150914 waren die Vorgängersterne stellare Giganten mit 40 bis 100 mal so viel Masse wie unsere Sonne, die am Ende ihrer Brennphase zu Schwarzen Löchern geworden waren. Im Laufe von vielen Milliarden Jahren näherten Sie sich an: durch Abgabe von noch sehr schwachen Gravitationswellen. Im Laufe von Milliarden von Jahren wurde dieses Einspiralen immer schneller und intensiver und in den letzten Sekunden beobachtbar. Da solche Doppelsysteme aus Schwarzen Löchern im kosmischen Maßstab nicht selten sind, konnte schon im Dezember 2015 ein weiteres Ereignis beobachtet werden.
Um jedoch auch die Verschmelzung masseärmerer Objekte wie etwa Neutronen-Doppelsterne beobachten zu können, musste die Empfindlichkeit von LIGO weiter verbessert werden. Im Zweiten Beobachtungslauf der Detektoren in den USA – am Ende der Laufzeit unterstützt vom europäischen Virgo-Detektor nahe Pisa – wurde tatsächlich im August 2017 das Signal vom Verschmelzen zweier Neutronensterne erkannt: GW170817. Dieses Signal war rund 100 Sekunden lang in den Detektoren sichtbar – gewissermaßen ein Glücksfall, weil die Objekte im Vergleich zu den zuvor beobachteten Schwarzen Löchern viel weniger weit von uns Entfernt waren und so die an der Quelle viel schwächeren Gravitationswellen stark genug für die Detektoren auf der Erde ankamen.
Was genau hat das Signal erzeugt?
Die Gravitationswellenastronomie hat im Vergleich zu Astronomie im elektromagnetischen Bereich (Licht, Radiowellen, Röntgenstrahlung) eine entscheidende zusätzliche Herausforderung: Sie kennt ihre Boebachtungsobjekte nicht im Voraus, und die Beobachtung selbst dauert nur wenige Sekunden. Trotzdem entstehen in den Graviationswellendektoren (LIGO Hanford, LIGO Livingston, Virgo nahe Pisa und KAGRA in Japan sowie GEO600 bei Hannover) ausreichend Daten, dass sich anhand der Form der Gravitationswellen rekonstruieren lässt, welche Objekte verschmolzen sind.
Durch genauere Analyse und Vergleich mit aufwändigen Modellrechnungen lassen sich sogar Aussagen über den inneren Aufbau der verschmelzenden Neutronensterne treffen. So wurde in den vergangenen Jahren die Physik dieser Objekte mithilfe der Gravitationswellenastronomie weiter vorangebracht.
Multi-Messenger-Astronomie
Ebenso wichtig für das Verständnis der Objekte, das über die reine Identifikation hinausgeht, ist die möglichst sofortige Beobachtung der Objekte mit anderen astrophysikalischen Sensoren, also gewöhnlichen Teleskopen und Teilchendetektoren. Anders als große Teleskope, die zu jedem Zeitpunkt nur eine sehr enge Himmelsregion betrachten können, sind Gravitationswellendetektoren immer rundum empfangsbereit – sogar durch die Erde hindurch, denn die Gravitationswellen werden durch nichts abgeschirmt. Daher wurden die Prozesse zur Identifikation von Gravitationswellen so stark automatisiert, dass unmittelbar nach dem Durchgang einer Gravitationswelle durch die Detektoren ein Alarm an andere Observatorien gesendet werden kann, die so schnell wie möglich dann die entsprechende Himmelsregion beobachten können.
Erste Kataloge der Ereignisse
In den ersten beiden Beobachtungsdurchgängen von LIGO (2015/16 und 2016/17) und Virgo seit dem 2. Halbjahr 2017 wurden insgesamt 11 Verschmelzungen massereicher Objekte beobachtet: 10 mal Doppelsysteme aus zwei Schwarzen Löchern, einmal aus zwei Neutronensternen. Zusammen mit dem dritten Beobachtungslauf (2019/20), der in seinen letzten Wochen durch den japanischen KAGRA-Detektor ergänzt wurde, konnte im November 2021 der Katalog auf 90 Gravitationswellensignale erweitert werden. Darin enthalten sind auch einige besonders ungewöhnliche Ereignisse, etwa ein Signal, in dem ein Neutronenstern mit nur der 1,17-fachen Masse der Sonne von einem Schwarzen Loch mit 32-facher Sonnenmasse verschluckt wird.
Möglich wurden die erweiterten Beobachtungsmöglichkeiten durch den Einbau einer speziellen Komponente, die sogenanntes Quetschlicht erzeugt. Diese Entwicklung aus Hannover verringert das Quantenrauschen des benötigten Laserlichts und macht die Detektoren noch empfindlicher für schwache Signale.
Der Vierte Beobachtungslauf: verbessertes Quetschlicht, KI und ein Rekord
Seit Mai 2023 läuft der vierte Beobachtungsdurchgang der Kooperation aus LIGO, Virgo und KAGRA. Er soll noch bis zum 18. November 2025 dauern und wird mit der bisher größten Empfindlichkeit der beteiligten Detektoren durchgeführt. Nicht nur wurden die Detektoren für den „O4“ gewartet, gereinigt und neu justiert, sondern auch verbessert: Das Quetschlicht wird mit Hilfe eines 285 Meter langen optischen Resonators noch einmal verbessert und kann so das Rauschen im Virgo-Detektor auf rund ein Drittel des vorigen Wertes verringern.
Auch künstliche Intelligenz hat in der Zwischenzeit in der Gravitationswellenastronomie ihren Einzug gehalten. Sie hilft dabei, die Richtung und die Ursprungsobjekte der Gravitationswellen schnell zu identifizieren und so möglichst schnell auch anderen Observatorien zu alarmieren, um ergänzend in vielen Wellenlängenbereichen der elektromagnetischen Strahlung zu beobachten. Besonders bei der Verschmelzung von Neutronensternen ist dies hilfreich: In nur einer Sekunde bestimmt ein künstliches neuronales Netz die Masse und die Rotationsgeschwindigkeit der Objekte sowie ihre Position am Himmel!
Einen Rekord konnte die LIGO-Virgo-KAGRA-Kollaboration im Juli 2025 vermelden: Zwei Schwarze Löcher mit 100 bzw. 140 Sonnenmassen wurden beim Verschmelzen beobachtet. Das Spannende: Schwarze Löcher mit solchen Massen sollte es nach gängigen Modellen der Sternentwicklung nicht geben! Allerdings waren die Gravitationswellenformen des Verschmelzungsvorgang von GW231123 so komplex, dass dies auf eine komplizierte Vergangenheit der beiden Schwarzen Löcher hindeutet: Möglicherweise sind sie schon selbst das Ergebnis einer Kollision leichterer Schwarzer Löcher.
Die Zukunft liegt im Weltall
Die Erfolge der erdgebundenen Gravitationswellenastronomie der letzten zehn Jahre gaben den entscheidenden Anreiz dafür, dass nun das seit Jahrzehnten in der Konzeption befindliche europäische Weltraum-Gravitationswellenobservatorium LISA gebaut wird. Mit dem geplanten Starttermin im Jahr 2037 und dem Beginn der Beobachtungen 2038 wird in etwas mehr als einem weiteren Jahrzehnt noch einmal ein ganz neues Kapitel der Gravitationswellenastronomie aufgeschlagen: Die verschmelzenden Schwarzen Löcher etwa werden dann nicht nur für einige Sekunden, sondern für Jahrhundert im Voraus in den Daten sichtbar werden. Außerdem sollten noch ganz andere Objekte und Ereignisse von den drei LISA-Raumsonden beobachtet werden können, etwa kompakte Doppelsterne oder sogar Überbleibsel-Signale vom Urknall.
Weitere Informationen
Kolophon
ist Astrophysiker und freier Wissenschaftskommunikator. Seit 2018 ist er Redakteur bei Einstein Online.
Zitierung
Zu zitieren als:
Jens Kube, “Zehn Jahre Gravitationswellenastronomie” in: Einstein Online Band 16 (2025), 16-1101